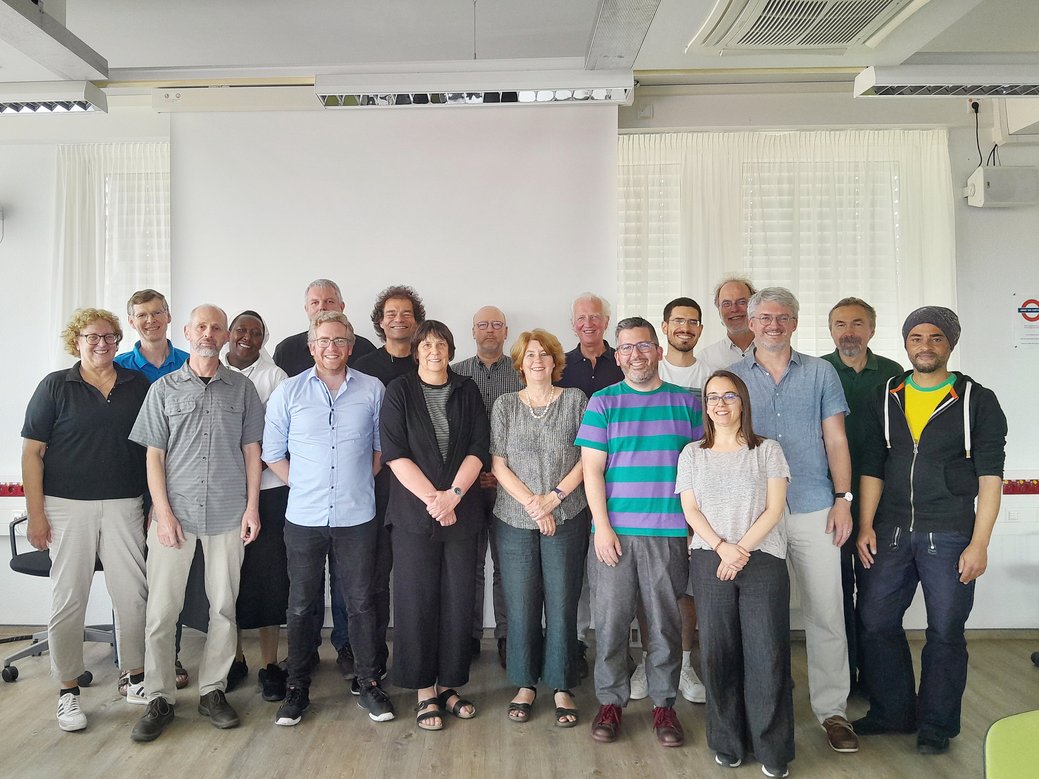
Dialog über Missionssammlungen schafft neue Perspektiven
Vom 16. bis 18. Juni 2025 trafen sich am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien (CERES) der Ruhr-Universität Bochum Vertreter:innen von sammlungshaltenden Einrichtungen (katholisch wie evangelisch), kirchlichen Dachverbänden, wissenschaftlichen Instituten sowie Museen oder Organisationen in öffentlicher Trägerschaft zu einem mehrtägigen Workshop mit dem Titel „Missionssammlungen: Ein Dialog zwischen Missionsgesellschaften, Orden und Forschungseinrichtungen“. Auf Initiative der Fachgruppe „Missionssammlungen“ der AG Koloniale Provenienzen des Arbeitskreises Provenienzforschung e.V. sowie des CERES und gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung diskutierten die Anwesenden Möglichkeiten und Herausforderungen der Forschung mit und in Missionssammlungen. Die Teilnehmer:innen formulieren gemeinsam die folgenden Beobachtungen, die sie für die künftige Auseinandersetzung mit Missionssammlungen für zentral halten:
- Missionssammlungen (auch „missionarische Sammlungen“ oder „missionsgeschichtliche Sammlungen“) sind ein bedeutender kultureller Bestand, der bislang noch zu wenig Aufmerksamkeit in sammlungshaltenden Einrichtungen, Forschung und Gesellschaft findet.
- Missionssammlungen bedürfen der Erschließung und Bearbeitung aus verschiedenen Perspektiven; sie sind ein Baustein in der Dokumentation und Diskussion der Vergangenheit und Gegenwart.
- Sammlungshaltende Einrichtungen wie wissenschaftliche Institute tragen eine Verantwortung für die kritische Auseinandersetzung mit der Sammlungs- und Entstehungsgeschichte der Bestände, auch im Hinblick auf die Epoche europäischer Expansion und des Kolonialismus. Dies beinhaltet zum Beispiel die Identifizierung von sensiblen Beständen.
- Die aktuellen Bemühungen um eine Erschließung und Bearbeitung von Missionssammlungen stehen in Kontinuität mit bereits erfolgten wissenschaftlichen und erschließenden Vorarbeiten.
- Missionssammlungen sollten von Beginn an in enger Kooperation von verschiedenen Akteur:innen erschlossen und bearbeitet werden; insb. sind die aktuellen Träger sowie Herkunftsgesellschaften der Sammlungen einzubeziehen.
- Die Kooperation muss transparent und verbindlich sein und sollte auf einem wechselseitigen, auch persönlichen Vertrauen basieren.
- Die anwesenden Vertreter:innen katholischer wie evangelischer Einrichtungen und wissenschaftlicher Institute sind für ihre jeweiligen Situationen und Bedürfnislagen sensibilisiert. Dies betrifft v. a. die verschiedenen und teils komplexen institutionellen Verfassungen sowie knappe Ressourcen und die Tatsache, dass sich viele der Sammlungen sich in privater Trägerschaft befinden.
- Die Bearbeitung der Bestände soll für alle Beteiligten einen konkreten Nutzen haben. So profitieren Orden und Missionsgesellschaften von der Sicherung eines bedeutenden Teils ihres kulturellen Gedächtnisses, Forschungseinrichtungen haben die Gelegenheit, mit wertvollem Material fachspezifische Forschungsfragen zu bearbeiten und gesellschaftliche, politische und kirchliche Akteur:innen profitieren von einer transparenten Bearbeitung (kolonial-)geschichtlicher Fragestellungen mit dem Ziel sozialer Gerechtigkeit.

